In den 1970er Jahren, als die sogenannten „Gastarbeiter“ aus dem damaligen Jugoslawien nach Österreich kamen, ist das Wort „Tschusch“ wieder auferstanden. Es steht als abfällige Bezeichnung für Menschen aus Slowenien, Kroatien oder auch Serbien. „Wir“, das waren die ÖsterreicherInnen, „die Anderen“ waren die „Tschuschen“, die Fremden, irgendwo zwischen Bedrohung und Abwertung angesiedelt. Oder, wenn ich mich an den schrecklichen Ortstafelsturm in Kärnten in den 1970er Jahren erinnere! Nur, weil manche Ortstafeln zweisprachig – deutsch und slowenisch – ausgeführt werden hätten sollen, schritt man seitens der deutschtümelnden KärntnerInnen zur Gewalttat. Und die FPÖ unter Haider wollte die zweisprachigen Ortstafeln später ebenfalls unbedingt verhindern.
Heute ist das nicht mehr so. Nicht nur, dass es nun zweisprachige Ortstafeln gibt, ohne dass sich jemand daran stört. Auf den Kommentarseiten verschiedener Onlineforen, insbesondere der Presse, findet man viele stramm rechte Recken, die für mich überraschend ganz anders argumentieren, als früher. Plötzlich sind SlowenInnen, KroatInnen, SerbInnen, ja alle EinwohnerInnen aus dem ehemaligen Ostblock, zum „Wir“ mutiert, zum anständigen, christlichen Europa. Jetzt wendet sich die Abwertung und das Bedrohungsszenario gegen die Moslems, vornehmlich aus der Türkei. Auch die FPÖ scheint das heute im Wesentlichen so zu sehen, wenn man den freundschaftlichen Kontakt zu Orbans Ungarn oder Putins Russland betrachtet. Und das in weniger als 1 Generation!
Die Grenzen zwischen „Wir“ und „den Anderen“ sind offenbar fließend. In der interessanten Dokumentation „Ein deutsches Leben“ berichtet die ehemalige Sekretärin von Joseph Goebbels, Brunhilde Pomsel, aus den Tagen des Dritten Reichs. Sie war im Jahr 1911 geboren worden, also am Ende des Zweiten Weltkriegs bereits 34. Und im Film erzählt sie, dass ihr bis dahin in ihrem gesamten Leben kein einziger Mensch begegnet ist, der nicht Deutsch als Muttersprache hatte! Bemerkenswert. Doch auch damals gab es „Wir“ und „Die Anderen“. Hitler wählte dafür die JüdInnen aus. Oft voll integrierte Menschen, die man beim besten Willen von außen gar nicht hätte als „anders“ erkennen können, wenn nicht durch den Taufschein bzw. die Geburtsurkunde.
Bekannte meiner Familie zogen aus beruflichen Gründen in den 1970er Jahren von Wien nach Vorarlberg. Dort waren sie die „Usländer“, mangels anderer Dichotomiemöglichkeit.
Heute, den 1. Juni 2017, zelebriert die Milchindustrie den „Welttag der Milch“ mit doppelseitigen Werbeschaltungen in verschiedenen Zeitungen. Der VGT nahm das zum Anlass, um eine andere Seite der Milchproduktion publik zu machen: das Schicksal der Milchkühe und ihrer Kälber. 4 AktivistInnen hatten den Mut, sich öffentlich an Melkmaschinen anschließen zu lassen. Die so gewonnene menschliche Muttermilch wurde direkt vor Ort einem Kalb verfüttert. Die „normale“ Situation also umgekehrt: Menschenmuttermilch für Kühe, statt Kuhmuttermilch für Menschen. „Meine Mama – meine Milch!“ stand auf einem Transparent.
Einige PassantInnen zeigten großen Ärger, ja, eine Waldviertlerin sagte sogar, man sollte uns in die Luft sprengen. Was für eine Frechheit, Menschen mit Tieren zu vergleichen! Menschen, das sind „wir“, aber Kühe, das sind „die anderen“. Und „die anderen“ kommen nach „den unsrigen“. Zuerst müssen wir uns um das Wohl der Menschen sorgen, erst dann um das Tierleid. Bei einem Interview mit einer liberal-intellektuellen Zeitung vor einer Woche in Lettland, warf mir der Journalist explizit vor, mit meinem Tierschutzaktivismus „meine Rasse“, gemeint die Menschen, zu verraten. „You are betraying your race“, meinte er und hielt sich für reflektiert. Die menschliche Rasse, das sind „wir“, die Tiere, das sind „die anderen“. Auch Florian Klenk vom Falter ließ das durchklingen, als er einen Artikel kritischen über unsere Tierschutzarbeit verfasste.
Offenbar müssen Menschen irgendwie zwischen „wir“ und „die anderen“ trennen. Wir brauchen immer Feindbilder, oder „Andersartige“, an denen „wir“ „unseren“ Zusammenhalt aufrichten können. Doch meine Hoffnung ist, dass diese Grenze fließen und sich verschieben kann. Wie die SlowenInnen in wenigen Jahren von „den Anderen“ zum „wir“ wurden, so könnte das vielleicht auch mit den Tieren gehen. Zumindest sollten wir uns bewusst machen, wie wenig objektiv fixiert diese Trennung ist, sondern vollkommen willkürlich und von unser Sozialisation abhängig. Von JournalistInnen liberaler Blätter hätte ich diese Reflektiertheit schon erwartet.



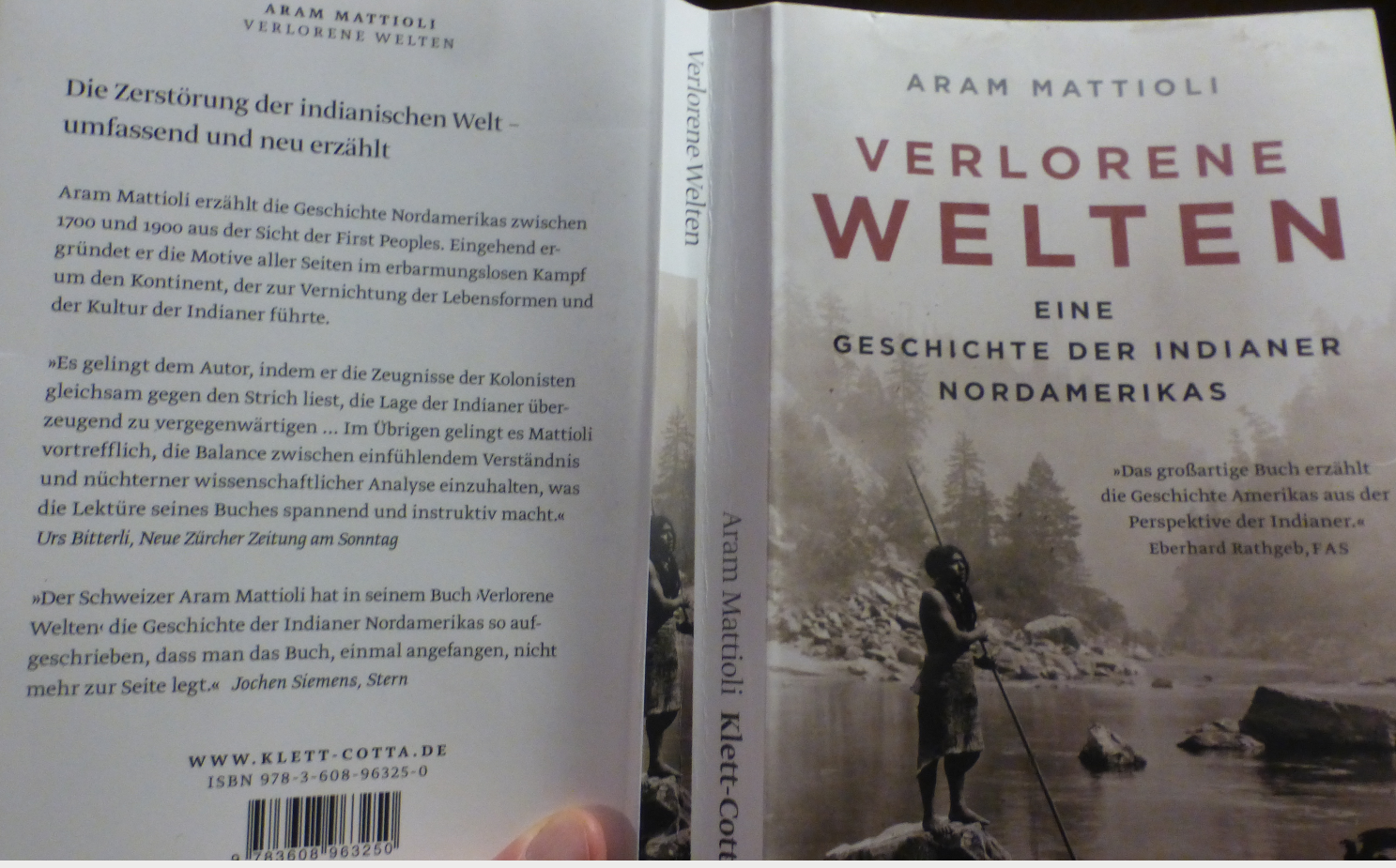
“Offenbar müssen Menschen immer zwischen ‘wir’ und ‘die anderen’ trennen.“ – Dafür habe ich mich für uns Menschen, jedenfalls für uns westliche Menschen, geschämt, bis ich vor ein paar Jahren den Befund einer Todesstatistik über Wölfe in einem USA- Nationalpark gelesen habe: Mehr Wölfe waren durch verschiedene Kriegsarten anderer Wölfe ums Leben gekommen als durch irgendeine andere Todesart.
Thomas Hobbes’ Wolfswarnung, wir seien dem anderen Menschen ein Wolf, nie sei uns zu trauen, jedenfalls ohne Staat nicht, traurig belegt?
“…Die Aggressivität des homo sapiens geht nicht nur auf den Kampf unserer tierischen Vorfahren um Ressourcen, Reviere und Sexpartner zurück. Paradoxerweise neigen wir auch deshalb zu destruktivem Verhalten, weil wir – wie alle sozial lebenden Tiere – gelernt haben, zu teilen, die Bedürfnisse anderer zu respektieren. Denn wer zum Überleben aufeinander angewiesen ist, tendiert dazu, sich gegen die Außenwelt abzugrenzen und rivalisierende Verbände als Gegner zu begreifen. … das gilt für viele Primaten, Wölfe, Delfine…“ (A. Rigos und A. Gjestvang: Unser finsteres Erbe. In: Das Böse nebenan. GEO kompakt Nr. 49. S.68. )
Weil Menschen sozial ausgerichtete Wesen sind, schaffen sie Feindbilder, um ihre Gruppe nach innen zu stärken. Das beobachtet man bei rivalisierenden Geschwistern, bei Hunden eines Rudels, die sich nicht sehr mögen, in der Politik: Eine Verfeindung nach außen stärkt durch Werteabgrenzung die Gruppe nach innen.
Die Leitlinie der Verfeindung?
“Entscheidend bei der Austragung gesellschaftspolitischer Konflikte in einer Demokratie ist es, dass sie konstruktiv bleiben, d.h., dass die Konflikte in einem offenen Schlagabtausch von Argumenten und Standpunkten bestehen und nicht in Hass und Feindschaft ausarten.“ Martin Balluch: Widerstand in der Demokratie. Wien 2009. S. 74.
Das müsste helfen.
Und das Wahr-nehmen unserer Verwandtschaft: Wir sind alle verwandt, wir Menschen, wir Menschen und unsere Hunde, wir Menschen und unsere Kühe.
Ich denke mir da oft, unserer westlichen posttheistischen welt ist oft noch immer stark beeinflusst von diesem abrahamistischen konzept der trennung von mensch und natur.. mensch als etwas was in die welt hineingestellt wurde, anstatt etwas was aus der welt hervorwächst.
kleine kinder können nicht unterscheiden, alles ist einfach ein zusammenhängender großer brei 🙂 erst später lernen wir dass es dies gibt und jenes und es gibt uns und die anderen etc. wir zerschneiden die welt die eigentlich ein verbundenes system ist. das ist auch notwendig um in dieser welt zu leben! aber ich denke es ist wichtig neben der analytischen sicht auch die “brei-sicht” zu haben, denn für ein sinnvolles leben braucht es beides.