Kürzlich wurde im New Scientist berichtet, dass bereits mehrmals Buckelwale gesichtet wurden, die ganz gezielt Seehunde retten, die von Orcas bedrängt werden. Bei einem der beschriebenen Augenzeugenberichte saß ein Seehund auf einem winzigen Eisfloß fest, während ein Orca versuchte, so wild Wellen zu schlagen, dass der Seehund vom Eis in das Wasser rutschen muss. Da griff ein Buckelwal ein, vertrieb den Orca und geleitete den Seehund in Sicherheit. Oder ein anderes Beispiel. Ein Video auf Youtube zeigt, wie ein Eisbär in einem Zoo eine Krähe sieht, die in seinem Gehege ins Wasser gefallen ist. Der Eisbär läuft hin, ergreift die Krähe – man hält kurz vor Entsetzen den Atem an – und setzt sie dann einfach vorsichtig ans Ufer. Oder ein weiteres Beispiel. Ein Nashornkind ist im Morast stecken geblieben, seine Mutter wartet, kann ihm aber nicht heraushelfen. Das Kind ist in Panik, gerät aber immer tiefer in das Schlammloch. Da kommt ein Elefant seines Weges, sieht die Situation und zieht das Nashornkind – gegen den Willen von dessen lautstark protestierender Mutter, die sich offensichtlich ängstigt – mit dem Rüssel aus dem Morast.
Ich finde solche Geschichten sehr beeindruckend und berührend. Ist ein Altruismus dieser Art nicht viel bewundernswerter, als Gewalt? Und offensichtlich ist er in der Natur gar nicht so selten. Aber manche unter uns empfinden da ganz anders. Für sie ist Hilfe für andere Tiere nur das Gewäsch von „Weicheiern“, die die reale Natur nicht verstehen würden. Dort herrsche nun einmal das Recht des Stärkeren, und der kenne kein Erbarmen. Dieses Gewaltbild der Natur geht immer mit einem Gefühl der Bedrohung durch die Natur einher. Die Welt sei ein ständiger Kampf und nur die Stärksten – die kein Mitleid kennen – würden sich durchsetzen. Ähnlich motiviert sind vermutlich Menschen, die nach der starken Hand des Staates in der Gesellschaft rufen und ein hierarchisches, dominanzbasiertes System bevorzugen. Auch in der Gesellschaft unter Menschen solle sich der Stärkere durchsetzen, Mitleid zu erregen sei nur ein Versuch der Schwachen, den Starken aufzuhalten. Insbesondere bei vielen JägerInnen fällt mir diese Einstellung auf.
Nennen wir dieses Weltbild das „Nagl-Syndrom“. Je bedrohter wir uns fühlen, desto eher kommt es in uns hoch. Statistisch gesehen ist es viel häufiger bei Männern. Verantwortlich dafür ist vermutlich die Geschlechterrolle, oder Gender, in der Gesellschaft. Ich merke das öfter bei meinen Schulvorträgen über Tierschutz. Während die Mädchen sich eher gegenseitig ihr Mitgefühl mit den Tieren bestätigen und öfter weinen, versuchen die Burschen sich gegenseitig eher darin zu übertrumpfen, wie kalt sie das lässt, wie cool brutal sie sein können. Eklatant das Geschlechterverhältnis bei den Mitgliedern im VGT: 78 % Frauen. Auch beim Vegetarismus und Veganismus scheinen die Frauen in der Statistik doppelt so häufig auf, wie die Männer. Und rechte Parteien haben deutlich mehr männliche als weibliche WählerInnen.
Aber das muss ja nicht sein. Starke Arme können auch schützen, nicht nur zerstören. In der Natur ist die Kooperation in Wahrheit häufiger, als die Konkurrenz. Einerseits muss man die Geschlechterrollen hinterfragen, dass Männer ihr Mitgefühl nicht zu unterdrücken brauchen. Andererseits aber kann man auch soziale Hilfe, Veganismus und Tierschutzaktivismus in die männliche Geschlechterrolle integrieren. Es gehört Mut und Härte dazu, in der Nacht in Tierfabriken zu filmen oder in kleiner Gruppe eine Treibjagd mit bewaffneten Menschen zu dokumentieren, oder sich auch der Polizei gegenüber durchzusetzen. Es gehört Mut und Rückgrat dazu, aus der Masse an TierproduktkonsumentInnen herauszutreten und zu seiner Meinung zu stehen und den Konsum von Tierprodukten abzulehnen.
Liebe Männer, überwinden wir doch den „Nagl“ in uns. Lassen wir das Mitgefühl zu, das genauso in uns steckt, wenn die Spiegelneuronen melden, wie es einem anderen Wesen geht. In der Welt, weder in der menschlichen Gesellschaft noch in der Natur, kommt es nicht darauf an, der Stärkste, Brutalste und Dominanteste zu sein. Kooperationsbereitschaft, Mitgefühl und Altruismus bringen uns in Wahrheit viel weiter. Lassen wir die Waffen doch einfach liegen und die Tiere am Leben. Die Welt ist doch für uns alle viel zu schön, um sie durch Gewalt zu verdunkeln.



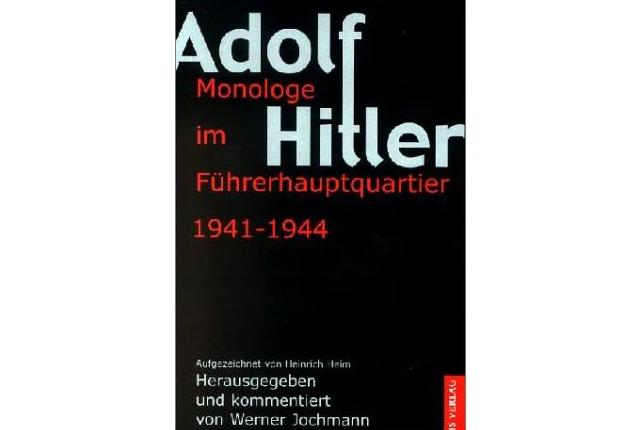
Inzwischen ist es einige Wochen her, da waren wir endlich nach einer Verletzung wieder in den Bergen unterwegs, mein Hund und ich; und wieder kam es zu einer Begegnung mit einem Jäger, die schwer zu vergessen ist.
Ich stand mit einer Karte in der Hand an einer Wegverzweigung,, meinen schlecht gelaunten Hund hatte ich an der Leine den Karrenweg hoch durch den Schattenwald gezogen und suchte nun nach einem Pfad. Da kam ein Mann aus dem Berghang, Gewehr über der Schulter, ganz in Grün: offensichtlich ein Jäger. Er fragte, ob er mir helfen könne mit dem Weg – wir kamen ins Gespräch. Ich solle meinen Hund angeleint lassen da oben, sagte er. Mir war es zu mühsam, ihm zu erklären, dass der Hund angeleint ist, weil er sonst mitten auf dem Karrenweg stehen bleibt, ich ihn aber ableinen werde, sobald das Gelände schwieriger (also Gamsgelände) wird, weil mein Begleiter dann nämlich plötzlich stundenlang herumspringen kann. Aber dann stellte sich heraus, dass ich den Jäger falsch verstanden hatte. Er hatte keine Angst um die Gämsen, er hielt den 8-kg-Hund für zu klein, um Gämsen zu schaden. Sondern er hatte Angst um den Hund, dass ein Gamsbock den Hund angreifen und mit seinem Geweih aufschlitzen könnte oder der Hund bei der Jagd vom eisigen Fels abrutschen könnte – er streckte dabei den Arm, der nicht das Gewehr hält, in die Luft und spreizte die Finger krampfhaft, als müsste er sich selbst in den Fels krallen. Warum er das machte, wurde dann klar. Er hatte nicht Angst um meinen Hund, sondern um mich, dass ich den Verlust meines Hundes nicht verkraften könnte. Während wir da herumstehen im Bergwald und nur das Gespräch weiterläuft, stellt sich heraus, dass der Jäger erst heute aus dem Bett gekommen ist. Das Bett hat er zwei Wochen lang kaum verlassen, denn er hat darin gelegen und geweint: Sein Hund ist ihm abgestürzt, fünfzehnt Tage zuvor, vom vereisten Felsen abgerutscht, bei der Jagd auf Gämsen. “Das ist schlimmer als davor, als mein Vater gestorben ist”, sagt der Jäger. “Das ist unvorstellbar schlimm.” und dann sagt er: Es ist nicht das erste Mal im Leben, dass dies Unvorstellbare passiert ist. Sondern das vierte Mal. Weil er Angst hat, dass ein anderer Mensch den Schmerz nicht ein einziges Mal bewältigen könnte, den er nun das vierte Mal verarbeiten muss, möchte er, dass mein Hund an der Leine bleibt. Sechs Hunde hat er gehabt in seinem Leben. Vier davon sind bei der Jagd auf Gämsen abgestürzt. Wieder spreizt er die nicht bewaffneten Finger: vier Mal! Jedes Mal hat er gewünscht, nicht alleine zurückbleiben zu müssen, und wollte sterben. Wieso in aller Welt kann er seinen Hunden nicht klar machen, dass sie bei hm bleiben müssen, wenn das ihr Leben kostet und er das seine dann am liebsten hinterher geben möchte? Aus ethischen Gründen, sagt er. Wenn eine Gams schlecht getroffen wurde, muss der Hund hinterher, damit sie vom Leiden erlöst wird.
Ich stehe im Bergwald und weiß, obwohl der Weg nun klar ist, nicht weiter. Der Jäger hat sich verabschiedet und geht, so allein, wie ein Mensch nur ein kann, sehr gebeugt und sehr langsam durch den Wald fort.
Menschen sind schwer zu verstehen.
Im Nagl muss ein anderer Nagl stecken. Schwer zu verstehen.
Vor einiger Zeit suchte ich nach einem Gamspfad in die Blauberge, den ich nicht fand, da kam ein Jägerjeep hinter mir her gefahren, hielt neben mir, Scheibe runter: Wehe Sie gehen mir da in den Wald; Sie wollen da wohl jagen, sagte ich, ja, sagte er, und Ihr Hund stöbert mir da das Wild auf; wehe Sie erschießen mir meinen Hund, dann können Sie gleich mich mit erschießen, leben will ich dann nämlich nicht mehr! – Ohne Antwort fuhr der Jeep fort, den Einstieg in den Pfad fand ich nicht, wollte fort vom Jäger und hatte Angst um meinen Hund. Da kam der Jeep zurück, hielt an, der Jäger stieg aus, kam auf mich zu: Herzklopfen! Das hat mir keine Ruhe gelassen, sagte er, dass Sie mir einfach sagen, ich solle Sie erschießen. Ich hab fast fünfundzwanzig Jahre in der Bergrettung gearbeitet, wie viele Menschen ich gerettet hab, weiß ich nicht mehr, so viele in all der Zeit, und jetzt kommen Sie und sagen, ich soll Sie erschießen! Nun traute ich mich nicht zu sagen, für mich s i n d Sie ein Mörder. Wie kann das für Sie so schlimm sein, Sie erschießen doch ständig?, fragte ich. Nun sah er aus, als würde er sich nicht trauen zu weinen, es aber gerne tun. Er ging zum Jeep, ich wusste, dass er etwas holen wollte, und hatte Angst, da war weit und breit niemand. Was er in den Händen hielt, waren aber zwei Flaschen Tegernseer Bier. Jetzt trinken Sie mit mir ein Bier, sagte er. Auf die, die ich gerettet hab. Und dann zeig ich Ihnen und Ihrem Hund den Pfad, den Sie suchen. So besoffen kann ich doch nicht in die Berge laufen, sagte ich. Aber ich trank mit ihm das Bier. Es war gut. Danke für die alle, die Sie gerettet haben, sagte ich, als er den Pfad gezeigt hatte.
Mein Hund mochte ihn, den anderen Nagl. Mir ist er lange nicht aus dem Kopf gegangen.
Die andere Seite, in allem.
Ich habe Angst, dass der Eisbär, der die ertrinkende Krähe rettet, ein Braunbär ist. Dem braunen Koloss habe ich in youtube beim Retten zugesehen, aus verschiedenen Perspektiven. Wenn so viele Bären so viele ertrinkende Krähen vor laufender Kamera retten, dann steigt die Angst in mir auf, wer sie ins Wasser schmeißt, um Klicks zu erkaufen.
Wenn wir genau hinschauen, erkennen wir dann das Gute und das Böse in allem?
Auch wenn das Syndrom natürlich was Negatives ist: Ich finde, das ist zuviel Ehre für den Dieter oder wie immer das Jägerlein heißt. Nenn’s doch lieber anders …